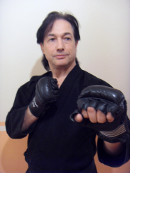Philospophie des JU-JUTSU
Geht man der Bedeutung des Wortes „JU-JUTSU“ auf den Grund, so steht JU bzw. JIU für „nachgeben, sanft, weich, ausweichen“ und JUTSU für „Technik bzw. Kunst“.
Ziel ist daher immer die Energie eines Angriffs umzulenken und dabei möglichst wenig Kraft einzusetzen.
Es gilt die Bewegungsenergie des Gegners zu nutzen, um sein Gleichgewicht zu brechen: Er soll durch seinen eigenen Angriff scheitern: Siegen durch Nachgeben.
Gerade für vermeintlich schwache Verteidiger, wie z.B. Frauen, Kinder und Jugendliche ist JU-JUTSU daher hervorragend geeignet.
JU-JUTSU - Gestern und Heute
Die Wurzeln des JU-JUTSU bzw. Jiu-Jitsu finden sich im feudalen Japan. Regiert durch einen Kriegsfürsten den Shogun, war das Land in einzelne Provinzen
aufgeteilt, verwaltet wiederum durch einzelne Lehnsherren, den Daimyos.
Deren Machtgarant waren ihre Samurais. Idealistisch betrachtet waren Samurais eine edle Kriegerkaste die dem Kodex des Bushido folgte.
Ihre Aufgabe war es das gemeine Volk zu kontrollieren und ihren Lehnsherr sowie dessen Herrschaftsgebiet zu verteidigen.
Das JU-JUTSU an sich ging aus der Kampfausbildung der Samurai hervor.
Ursprünglich sollten diese sich auch ohne Waffen verteidigen bzw. den Gegner töten können und wurden daher auch im waffenlosen Kampftechniken
und Taktiken unterrichtet.
Diese Techniken wiederum wurden in ihrer Urform aus China importiert.
Da die Beherrschung dieser Kampfkunst über Leben oder Tod entschied, wurde sie mit dem entsprechenden Ernst geübt und weiterentwickelt, jeden Tag ein
ganzes Leben lang.
JU-JUTSU in dieser Ernsthaftigkeit in unserer heutigen Zeit zu praktizieren ist für die meisten illusorisch: Schule, Freizeit, andere Interessen, Arbeit,
Familie, Freundschaften, da bleibt für eine Kampfkunst nicht die Zeit die sie verlangt.
Auch die Ausrichtung auf den Kampf um Leben und Tod ist heute nicht mehr gegeben.
JU-JUTSU ist aber auch als Sportart hervorragend dazu geeignet sich körperlich weiterzuentwickeln und sich selber besser kennen zu lernen.
Eine Grundvoraussetzung um in extremen Situationen bestehen zu können.
Geschichte des JU-JUTSU in Deutschland
Die Selbstverteidigung hat auch in Europa eine jahrhunderte alte Tradition. Die Beschreibung von Techniken wie Hebel und Würfe finden
sich bereits beispielsweise im „Talhofferschen Fechtbuch“ /Hans Talhoffer (1443)/, im „Fechtbuch“ /Alfred Dürer (1512)/ oder auch etwa in der Schrift
„Worstel-Konst“/Nicolaes Petters (1674)/.
Durch die Entwicklung von modernen Waffensystemen jedoch wurden in den folgenden Jahrhunderten die Weiterentwicklung von Nahkampf- und
Selbstverteidigungstechniken vernachlässigt.
Als Wegbereiter des deutschen Ju-Jutsu sind Erwin von Bälz und Erich Rahn zu nennen. Bälz unterrichtet von 1876 bis 1902 an der medizinischen
Fakultät der Kaiserlich-Japanischen-Universität in Tokio.
Im Zuge seines Aufenthalts in Japan lernte er Jiu-Jitsu durch Aufführungen des 70 Jahre alten Jiu-Jitsu-Lehrers Totsuka kennen.
An der Universität wiederum empfahl er seine Studenten Jiu-Jitsu zur Körperertüchtigung. Einer dieser Studenten soll Jigoro Kano gewesen sein,
späterer Begründer des Judo.
Rahn verfolgte in Berlin einen Schauwettkampf von Katsukuma Higashi im Zirkus Schumann. Beeindruckt lernte er Jiu-Jitsu, unklar ist hierbei
ob als direkter Schüler von Higashi oder nicht, und eröffnete dann 1906 seine erste Jiu-Jitsu-Schule in Berlin.
Rahn unterrichtete schließlich Berliner Polizisten in dem durch ihn als „Sanfte Kunst“ in Deutschland bekannt gewordenen Jiu-Jitsu.
Später folgte die Schulung von Polizisten in anderen deutschen Städten.
Weitere Jiu-Jitsu-Schulen entstanden in Frankfurt, durch Alfred Rohde, der 1933 auch die Europäische Judo Union (EJU) gründete, und in
Wiesbaden durch Otto Schmelzeisen.
Der Erste Reichsverband für Jiu-Jitsu wurde 1923 gegründet. Um bei Wettkämpfen ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, führte man, wie beim
mittlerweile weltweit etablierten Judo, ein entsprechendes Regelwerk ein, das allerdings den Selbstverteidigungscharakter des praktizierten
Jiu-Jitsu beschnitt.
Nach dem zweiten Weltkrieg waren Jiu-Jitsu und Judo in Deutschland durch die Alliierten verboten.
Dennoch wurden diese Kampfsportarten unter anderen Namen wie Bodengymnastik oder Geschicklichkeitssport weiterbetrieben.
Um die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen wieder zu ermöglichen, hob man das Verbot von Judo zügig wieder auf.
Die deutschen Judoka organisierten sich schließlich 1952 im Deutschen Dan-Kollegium (DDK) und 1953 im Deutschen Judo Bund (DJB).
Für die Entwicklung des „deutschen Ju-Jutsu“ durch eine Kommission des DDK gibt es je nach Quelle verschiedene Auslöser.
Der ersten Variante nach führte die Ausrichtung des Judo als Wettkampf-Sportart zu einer Vernachlässigung des Selbstverteidigungsaspekts bzw. der Ausübung
des Jiu-Jitsus, was vielerorts z. B. durch Werner Heim bemängelt wurde.
Um diesem entgegenzuwirken wurde auf Antrag der Hessischen Landesgruppe 1966 beim Deutschen DAN-Tag die JU-JUTSU-Kommission gegründet.
Die zweite Variante nennt als Ursache die Beauftragung durch das Bundesinnenministerium zur Entwicklung eines effektiven Nahkampf- und
Selbstverteidigungssystems für Polizei und Streitkräfte.
Unbestritten ist, dass die Kommission das Ziel hatte ein technisches Programm für realistische Selbstverteidigung zu entwickeln, dass
sich aus den Disziplinen Jiu-Jitsu, Judo, Karate und Aikido zusammensetzt.
1968 verabschiedete man schließlich die entsprechende Prüfungsordnung am Deutschen-DAN-Tag.
Das neue Programm trat am 22.4.1969 in Kraft: die Geburtsstunde des deutschen JU-JUTSU.
Die ersten Dan-Prüfungen fanden am 29.6.1969 statt. Von 30 Prüflingen bestanden letztendlich fünf die Prüfung zum 1. Dan: R. Unterburger, H. Groß,
W. Heim, F.J. Gresch und E. Reinhardt.
Die Ju-Jutsu-Kommission wurde zunächst von W. Heim (Prüfungswesen) und F. J. Gresch (Sachbearbeiter für Technik und Öffentlichkeitsarbeit) gebildet.
Der neue Stil blieb jedoch nicht ohne massive Kritik aus dem Lager des Judo.
Trotzdem entwickelte sich das JU-JUTSU technisch weiter und stellt nach wie vor eine effektive Methodik zur Selbstverteidigung dar. Hierzu haben vor allem V. Schmidt, P. Nehls, J. Art und E. Reinhardt Ihren Teil beigetragen.
Aufgrund von Unstimmigkeiten im Deutschen Ju-Jutsu Verband (DJJV) in Bezug auf Lehre und Form und dem damit einhergehenden Konflikt zwischen Tradition
(einheitliches Programm der Grundtechniken bis in die Meistergrade) und Moderne (flexible Trainingsform und Technik), kam es jedoch in den Jahren 1985 bis 1989
zum Bruch und es bildeten sich neue Ju-Jutsu-Verbände heraus.
Vlado Schmidt schloss sich dem 1988 gegründeten Bund Deutscher Ju-Jutsuka e.V. an, in dem fortan sein System gelehrt wurde und wird. Grundsatz
des BDJJ e.V. sind Toleranz gegenüber anderen Selbstverteidigungsdisziplinen und offene variable Techniken (mit und ohne Waffen) die ständig dem
aktuellen Wissensstand angepasst werden.
Quellen:
- F. J. Gresch: Chronik des Ju-Justu: Ein historischer Rückblick
- V. Schmidt: Geschichtliche Aspekte – Ju-Jutsu Lehrbrief